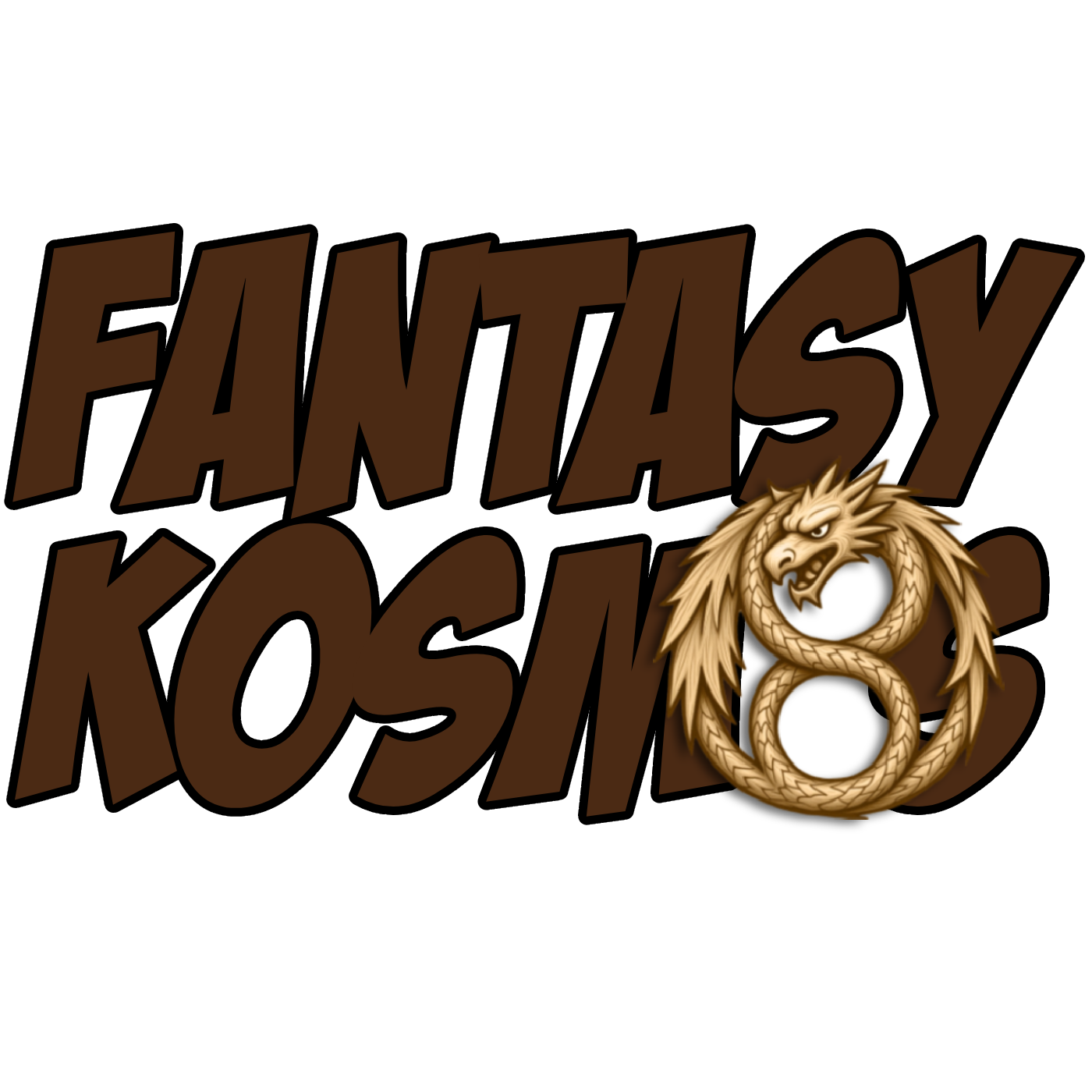🔍 Suche im Fantasykosmos
Spüre verborgene Pfade auf, entdecke neue Werke oder durchstöbere das Archiv uralter Artikel. Ein Wort genügt – und der Kosmos öffnet sich.
🔥 Teil III: SPLITTER DER GEDULD (116)
Wie Sanderson uns in zehn Bänden eintrichtern will, dass totale Lese-Erschöpfung neuerdings eine Fantasy-Tugend sein soll.
1. Der Fluch der Wiederholung: Das große narrative Karussell
Zehntausend Seiten. Zehn Bände geplant. Vier veröffentlicht – wir reden hier von der englischen Originalversion und nicht vom mehr als verdoppelten Kaufvergnügen in deutscher Sprache – dazu kommen wir später noch. Doch schon jetzt ist klar:
Es ist, als würde man dieselbe Geschichte durch einen Mixer aus neuen Perspektiven jagen – und beim Rausgießen merkt man: Es war die ganze Zeit über dieselbe Suppe.
Kaladin? Noch immer depressiv. Noch immer ehrenhaft. Noch immer auf dem Weg zu einem Ideal, das ständig kurz vor dem nächsten Kapitel wegdriftet.
Shallan? Längst dreigeteilt. Gefühlt hat jede Identität inzwischen ein eigenes Tagebuch.
Dalinar? Führt Verhandlungen mit gottgleichen Entitäten, aber ehrlich: Man sehnt sich zurück nach dem Dalinar, der einfach nur Dinge kaputtgehauen hat.
Szeth? Existiert irgendwo zwischen Gehorsam, Blutspur und moralischem Realitätsverlust.
Und das Schlimmste daran?
Es fühlt sich nicht an wie Charakterentwicklung, sondern wie ein massiver Zeitschleifenfehler. Und du weißt, dass das für dich als Leser niemals gut ausgehen kann.
2. Handlungslücken mit Hochglanzlack
Es gibt diese Kapitel, in denen angeblich alles passiert.
Kämpfe, Erkenntnisse, große Wendepunkte.
Aber wenn man genauer hinsieht, merkt man: Es ist nicht das, was passiert – es ist das, was gesagt wird, dass vorgeblich passiert sei. Wir gucken dumm, grübeln einen Moment und reagieren dann mit der mittlerweile zum Ritual gewordenen Ach-egal-Bindung.
Sanderson erzählt oft nicht in Form einer klassischen Handlung, sondern mit der abstrusen und meist dysfunktionalen Technik einer Art permanenter Nachbesprechung.
Ein bisschen wie wenn du einen Film schauen wolltest, aber dummerweise die Tür zur Pressekonferenz danach genommen hast.
Man wünscht sich manchmal einen ganz simplen Satz:
„Und dann stürmten sie das Tor.“
Stattdessen bekommen wir:
„Der Gedanke an das Stürmen des Tores erinnerte ihn an seine Kindheit in Kholinar, an die Art, wie seine Mutter das Brot schnitt, und daran, wie Verantwortung in Zeiten des Sturms mehr war als Pflicht – es war Bindung.“
3. Der Kult um Sanderson
Die vermeintliche Unantastbarkeit von Brandon Sanderson liegt nicht in der Größe seiner Geschichten begründet.
Sie ist Ergebnis einer permanenten Meinungsschlacht in den Kommentarspalten.
Wer die Sturmlicht-Chroniken kritisiert, wird behandelt, als hätte er einem Hohepriester eines gerade mega-angesagten Kultes den Kelch zerbeult.
„Du verstehst es einfach nicht“, heißt es dann.
Oder: „Warte, bis Band 7 alles erklärt.“
Wir sagen:
Vielleicht liegt das Problem nicht bei den Erwartungen der Leser –
sondern bei der inneren Schutthaldigkeit einer Reihe, die nie gelernt hat, etwas Unwichtiges einfach mal wegzulassen – oder gleich wegzuschmeißen. Alleine im Fundus der überbordenden Anzahl an Nebendarstellern und Handlungsnebenarmen gäbe es davon wahrlich genug.
4. Wenn alles gleich klingt: Der Fluch des Stil-Konsens
Es gibt diesen Punkt, an dem du merkst:
Alle reden gleich.
Nicht dieselbe Meinung – dieselben Worte.
Ob König, Knappe, Klingenherold oder Sprengsel:
Sie alle klingen wie Sandersons innerer Vortrag vor einem Publikum, das nicht weglaufen kann.
Die Dialoge rauschen wie Podcast-Skripte an dir vorbei. Hochpoliert. Pointiert. Unlebendig.
Es ist das literarische Äquivalent zu Zuckerguss auf Styropor.
Du erkennst die Besonderheit, aber du willst da in Dreiteufelsnamen nicht reinbeißen.
5. Fazit: Die große Geste – und das leere Zentrum
Was bleibt, wenn man Sanderson den Weltenbau, die Ordnungssysteme, die Infodumps und die wortreichen Rituale wegnimmt?
Eine Geschichte, die sich nicht traut, einfach mal frei von der Leber weg zu erzählen.
Wir wollten einen Sturm.
Wir bekamen ein grollendes Irgendwas in zehn Bänden.
Und ja – zehn.
Denn im deutschsprachigen Raum wurde jeder Originalband aufgeteilt.
Aus vier Romanen wurden zehn.
Zehn Brocken, zehn Hardcover, zehn Mal Hoffnung, zehn Mal Ernüchterung – na ja… neun Mal fairerweise. Zehn Mal Zahlemann und Söhne.
Man hat nicht nur das Gefühl, das Epos zieht sich –
es zieht sich mit deutscher Gründlichkeit auf doppelte Länge.
Da wird ein Fantasyprojekt zur Ausdauerprüfung,
zur literarischen Nordwandbesteigung im Nebenfach „Exposition mit Sprengselbeilage“.
Und irgendwann – auf Seite zweitausendirgendwas –
fällt einem der letzte Splitter Geduld aus der Hand.
„Erwartung bedeutete nicht nur, was andere von einem erwarteten. Es ging darum, was man selbst von sich erwartete.“
Vielleicht ist genau das der Kern des Problems.
Denn während Sanderson von sich erwartet, alles zu erklären,
erwarten wir von einem Fantasyepos diesen Zuschnitts vor allem eines:
Richtig geile Magie. Und ganz bestimmt kein Info- und Entitäten-Management.
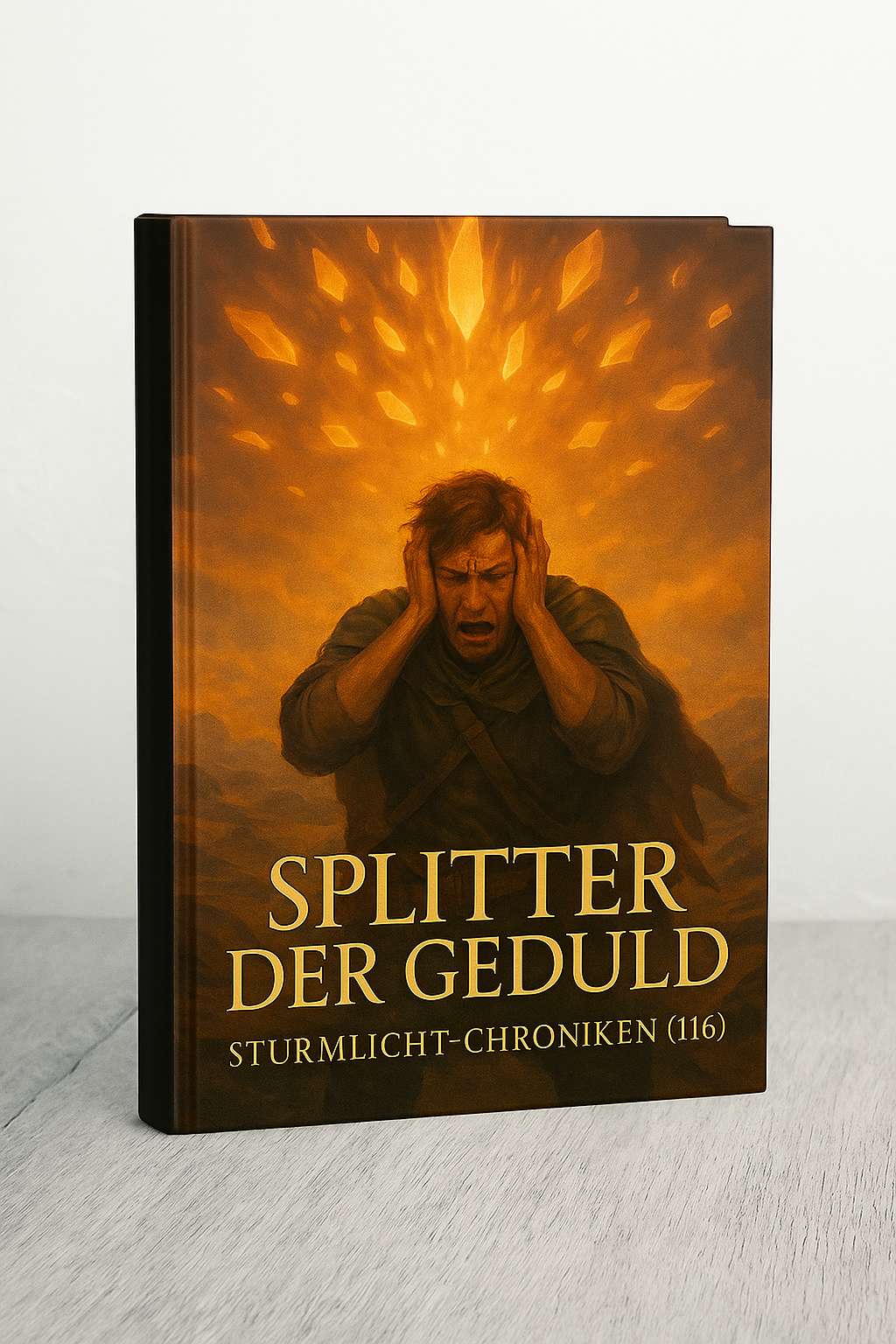
Alle Teile unserer endgültigen Sturmlichtchroniken-Abrechnung im Überblick:
Teil 1: „Einst war da Spannung… und dann kam Kapitel 238“
Teil 2: „VERSPRENGTE SPRENGSEL (115) Oder: Warum man Fantasy Romane nicht wie juristische Fachbücher schreiben sollte.“
Teil 3: „SPLITTER DER GEDULD (116) Wie Sanderson uns in zehn Bänden eintrichtern will, dass totale Lese-Erschöpfung neuerdings eine Fantasy-Tugend sein soll.“
Richtige Buchempfehlungen für dich?
Auch ohne die Sturmlicht-Chroniken ist Fantasy verdammt cool. Besuche unsere Fantasy Roman Rezensionen. Mehr schicken Stoff für Augen und Ohren bekommst du auf der Phantastik-Couch, die wir ebenfalls sehr empfehlen können.