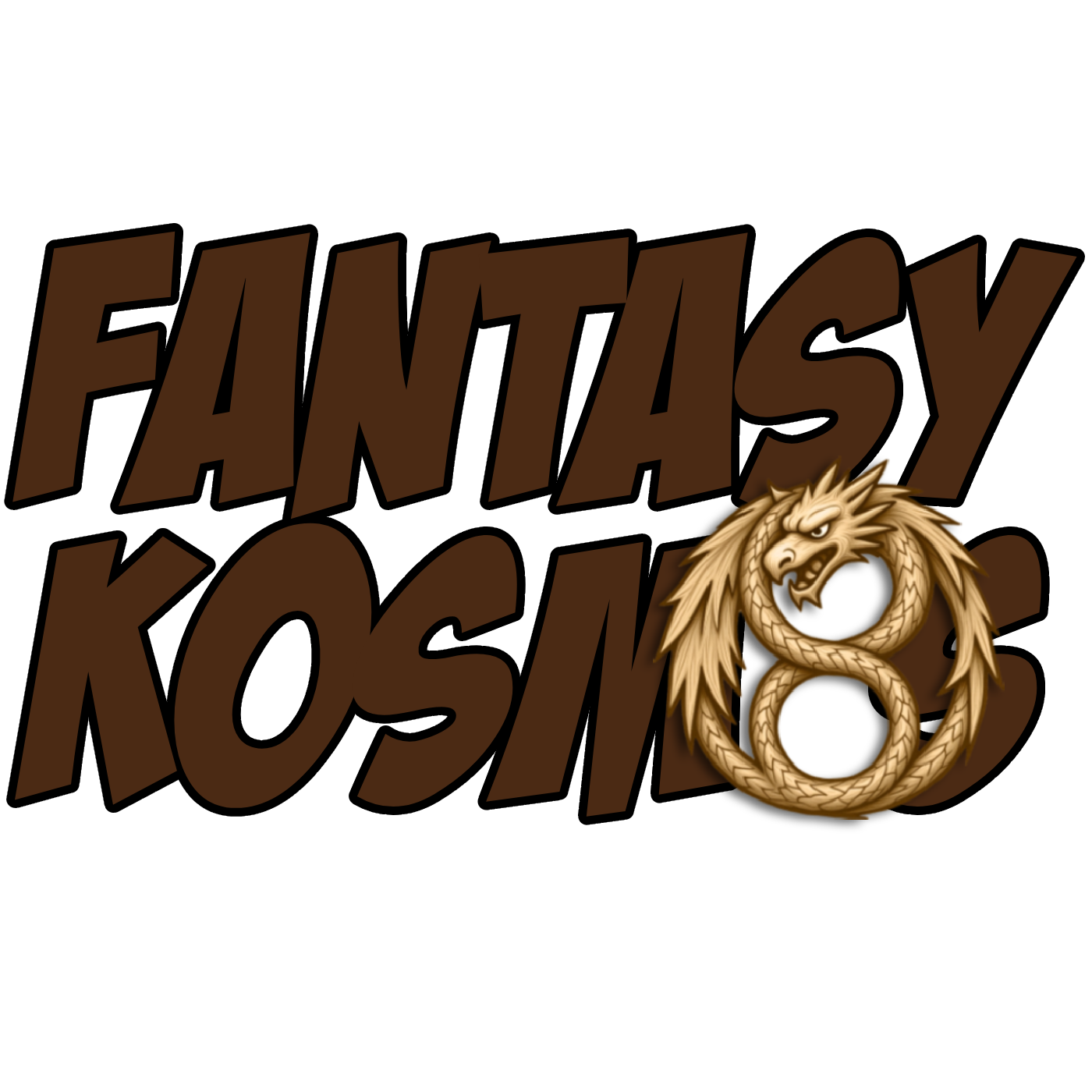🔍 Suche im Fantasykosmos
Spüre verborgene Pfade auf, entdecke neue Werke oder durchstöbere das Archiv uralter Artikel. Ein Wort genügt – und der Kosmos öffnet sich.
🔥 Teil I: „Einst war da Spannung… und dann kam Kapitel 238“
Wie Brandon Sanderson uns mit Glanzsplittern blendete und mit Sprengseln schließlich in den Wahnsinn trieb
1. Der verheißungsvolle Anfang: Hoffnung keimt auf
Weißt du noch, wie es war?
Band 1, The Way of Kings. Ein Einstieg wie aus dem Fantasy-Bilderbuch, quasi den Staub eines wirklichen Königsweges unter den literarischen Latschen spürend: Kaladin, zerschunden, gefesselt, verstoßen – und doch voller Wucht. Ein Beispiel für unbändigen Überlebenswillen in einer durch und durch tödlichen Welt. Dalinar Kholin, kriegsgegerbt, visionsgeplagt, eine Art fantasyhafter Ned Stark mit moralischem Rückgrat. Shallan Davar, jung, clever, dreist. Szeth, der tragische Attentäter – ein Highlight jeder Szene, in der er auftrat.
Wir waren drin, oh ja. Gefesselt.
Nicht von magischen Ketten, sondern von unserer eigenen Erwartung. Das hier, dachten wir, könnte das nächste große Ding sein.
Spoiler: War’s nicht. Es war das nächste endlos lange Ding.
2. Und dann kam das Erklärbär-Massaker
Je weiter die Bände der Sturmlicht-Chroniken fortschreiten, desto mehr wird klar: Sanderson traut uns nicht. Oder sich selbst.
Statt Charakterentwicklung? Die zäheste Sprengler-Metaphysik ever.
Statt Plot? Zitatähnliche Monologe über Ideale, Ehrenkodizes und innere Zerrüttung.
Kaladin, der depressive Supermann mit eingebautem Heroismus-Verhinderer, wird zum emotionalen Kreisverkehr: immer dasselbe Thema, immer dieselbe Abzweigung – immer wieder zurück zum Selbstzweifel.
Shallan? Zersplittert sich nicht nur psychisch, sondern narrativ. Jede ihrer Persönlichkeiten bekommt inzwischen gefühlt ihr eigenes POV-Kapitel.
Szeth, einst ein wandelndes Moraldrama, wird in späteren Bänden zur kreischenden Karikatur, die einem Schwert folgt, das mehr Screentime kriegt als der Plot.
Und Dalinar? Vom moralischen Kompass zur peinlichen Symbolfigur mit messianischem Komplex – seine Visionen riechen inzwischen mehr nach Plotkleber als nach Offenbarung.
„Leben vor Tod. Stärke vor Schwäche. Reise vor Ziel.“ Ganz ehrlich: Man hätte damals schon stutzig werden müssen. Es ist das literarische Äquivalent zu: „Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch werden.“ Nur halt mit Schwertern. Wahlweise hätte man es auch als Werbeslogan für schweineteure Premium-Yoga-Matten nehmen können.
3. Die Sprengsel-Apokalypse
Früher dachte man: „Oh, Syl, wie süß.“
Heute kannst du dieses enervierende Kichern dieser huschenden Quälgeister nicht mehr hören. Wenn wieder eines der Dinger angeflirrt kommt, würdest du dich am liebsten selbst in instabiles Uran verwandeln. Also: „Zeig mir deine Zerfallskette, Syl – und nimm Wyndle bitte gleich mit.“
Die Sprengsel sind nämlich mittlerweile genau das, wovor wir oft genug gewarnt haben. So etwas passiert, wenn man eine Prise Elantris, ein bisschen Pixar und einen Schuss LSD zusammenrührt – und dann auf Dauerschleife stellt.
Syl, Pattern, Wyndle, Ivory – sie alle nerven, labern, philosophieren und klugscheißern sich durch Dialoge, die klingen wie die nervige Hausarbeit eines besonders motivierten Philosophie-Erstis.
Und diese Viecher sind überall.
Man kommt nicht an ihnen vorbei, kann sie auch nicht überblättern. Sie kommentieren, sie klittern, sie richten – aber sie erzählen nichts Neues. Es sind keine Charaktere, sondern moralische Chatbots mit Glitzerhaar. Es fühlt sich tatsächlich so an, als hätte man welche an den Fingern kleben, wenn man das Buch endlich wieder schließen darf.
4. Wüstwerdung: Wenn Welt und Handlung austrocknen
Die Wüstwerdung als globales Setting hätte dramatisch sein können.
Ein sterbender Planet! Wetterkatastrophen! Ressourcenknappheit!
Vielleicht noch eine Gottheit à la Trump, die die Wüstwerdung zur alternativen Feuchtigkeit erklärt und auf einem steinernen Podium ruft: „Niemand versteht mehr von Bindungen als ich. Ich bin der Beste in Gravitation. Die Bindungen lieben mich. Alle lieben mich.“
Stattdessen: Steine. Gestein. Noch mehr Gestein. Kapitel über Gestein. Ein steinernes Jammertal in Weltengröße.
Und zwischendrin ein Heer von Strahlenden Rittern, die so dringend mal eine Gruppentherapie bräuchten, dass Galadriel höchtpersönlich den Bus ins Elrond-Institut für maximal verstrahlte Eidbrecher fahren würde.
Die Strahlenden wirken immer mehr wie ein richtig schlechtes Superheldenteam, dessen Fähigkeiten niemand genau versteht – am allerwenigsten der Leser. „Eidtore“, „Ideale“, „Splitterpanzer“, „Bindungen“ – klingt alles toll, fühlt sich aber zunehmend an wie ein Fantasy-Kongress mit einem völligen Overkill bei den PowerPoint-Folien.
5. Zwischenfazit: Von der Faszination zur Frustration
Sorry, aber hier müssen wir ehrlich sein.
Wir haben uns am Anfang geblendet gefühlt – von der Größe, der Tiefe, dem Weltenbau.
Doch irgendwann begannen wir zu merken: Das hier ist kein Epos, das ist ein literarischer Staffellauf mit Bleigewichten.
Man liest nicht mehr, weil man es liebt.
Man arbeitet es ab, weil man wissen will, ob es irgendwann mal wieder Fahrt aufnimmt.
Es ist wie ein Pflichtbesuch bei einer ehemaligen Lieblingsband, die jetzt Synthpop mit Panflöte macht. Man wartet auf dieses eine geile Riff, das aber nie mehr kommt. Und ja, wir wissen das auch längst.
6. Vorschau auf Teil II: Exposition – das Brettspiel
Wenn du denkst, es geht nicht langatmiger, setzt Sanderson noch einen drauf:
Nächste Woche nehmen wir das berüchtigte Magiesystem der Sturmlicht-Chroniken auseinander – jenes Regelwerk, das mehr Unterpunkte hat als eine Steuererklärung im Alethi-Reich.
Und wir sprechen über das, was Fantasy eigentlich ausmachen sollte: große Geschichten, keine Anleitungen zur metaphysischen Buchführung.
Bereite dich vor auf das nächte Kapitel unserer strahlenden Sturmlicht-Chroniken Abrechnung:
„Ich wollte Magie. Und bekam eine verdammte Management-Simulation für völlig zurecht sterbende Reiche.“
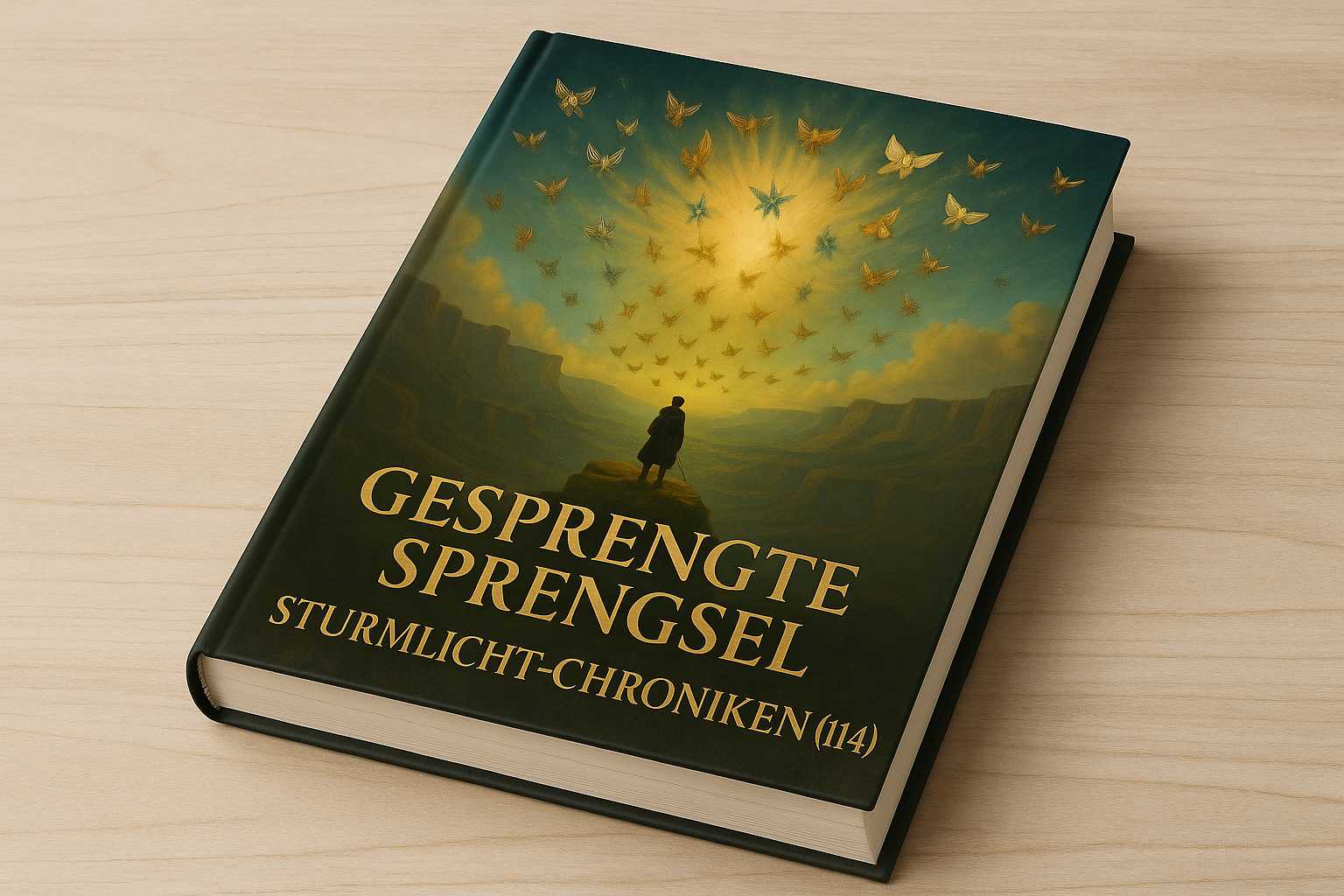
Alle Teile unserer endgültigen Sturmlichtchroniken-Abrechnung im Überblick:
Teil 1: „Einst war da Spannung… und dann kam Kapitel 238“
Teil 2: „VERSPRENGTE SPRENGSEL (115) Oder: Warum man Fantasy Romane nicht wie juristische Fachbücher schreiben sollte.“
Teil 3: „SPLITTER DER GEDULD (116) Wie Sanderson uns in zehn Bänden eintrichtern will, dass totale Lese-Erschöpfung neuerdings eine Fantasy-Tugend sein soll.“
Richtige Buchempfehlungen für dich?
Oh doch, wir kennen da besseres als die Sturmlicht-Chroniken. Besuche unsere coolen Fantasy Roman Rezensionen. Mehr fantastischen Stoff für Augen und Ohren bekommst du auf der Phantastik-Couch, die wir ebenfalls sehr empfehlen können.